Stephen Hawking
Ein Treibstoff namens Zuversicht
Auf düstere Nachrichten reagieren viele mit Angst, Wut oder Zynismus. Stephen Hawkings Geschichte zeigt, wie man selbst in scheinbar ausweglosen Situationen den Lebensmut bewahrt.
Von Ulrich Schnabel
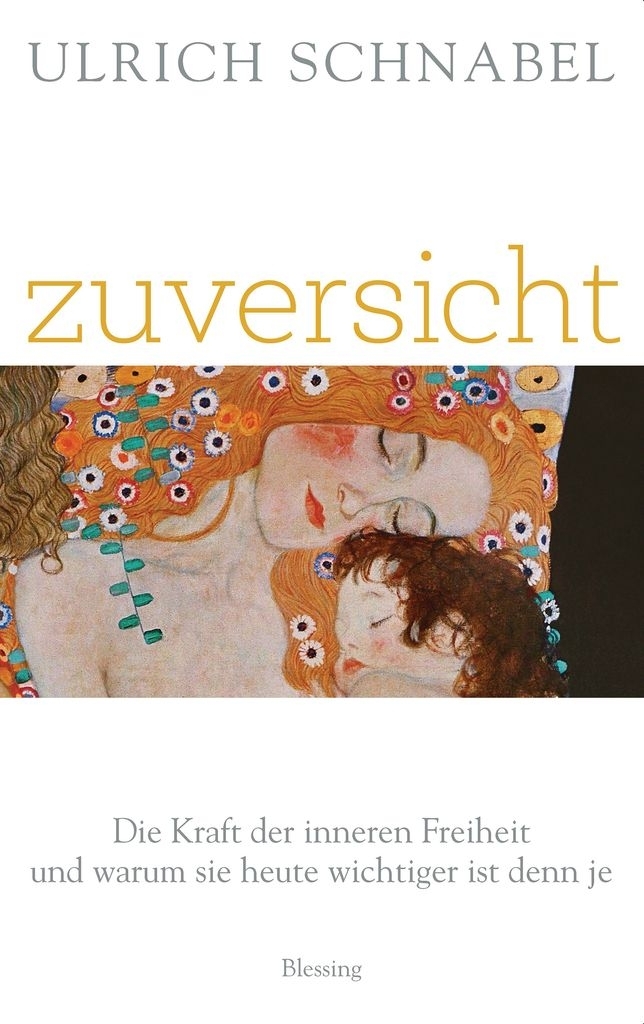
Stellen Sie sich vor, Sie starten in Ihr Erwachsenenleben, sind Anfang 20 und voller Ideen und Zukunftshoffnung. Da wird bei Ihnen eine rätselhafte Krankheit diagnostiziert, die unheilbar ist und – so eröffnen Ihnen die Ärzte bedauernd – allmählich zur Lähmung und über kurz oder lang zum Tod führen wird. Wie viele Jahre Ihnen noch bleiben, kann niemand genau sagen, aber den betroffenen Mienen der Ärzte entnehmen Sie, dass es offenbar nicht mehr allzu viel Zeit sein wird.
Wie gehen Sie damit um? Wüten Sie gegen Ihr Schicksal und stürzen sich in eine Verzweiflungsaktion? Versinken Sie in Selbstmitleid und einem depressiven „Es hat ja alles eh keinen Sinn mehr“-Gefühl? Oder hoffen Sie auf ein Wunder und bitten Sie – je nach Glaubensrichtung – um eine Audienz beim Papst/Dalai Lama/Wunderheiler?
Das ist mehr als ein hypothetisches Gedankenspiel. Es ist einerseits die Geschichte eines persönlichen Schicksals; andererseits ist es eine gute Metapher für das Lebensgefühl unserer Zeit, das von Krisen- und Endzeitstimmung geprägt ist. Angesichts einer Vielzahl existenzieller Bedrohungen – Politkrisen, Terrorismus, Atomkriegsgefahr, Klimawandel – wirkt das demokratische System wie von einer schweren Krankheit befallen, von einer Art politischer Lähmung, für die es keine rettende Therapie zu geben scheint. Zwar kann niemand sagen, wie lange die gewohnten Mechanismen noch funktionieren, doch der Zusammenbruch scheint nur noch eine Frage der Zeit.
Die Gesellschaft reagiert auf diese Krisenstimmung ähnlich wie ein Todkranker auf die Nachricht von seinem baldigen Ende: Nicht wenige Bürger flüchten sich in Wut und Verzweiflung, toben ihre Angst und ihren Hass in sozialen Netzwerken oder radikalen Parteien aus; andere versinken in Depression, ziehen sich zurück und lesen Bücher wie Houellebecqs Unterwerfung oder Sarrazins Deutschland schafft sich ab, die mit großer Geste den Untergang des Abendlandes beschwören.
Stephen Hawking hat nichts von alledem getan, als ihm sein bald bevorstehendes Ende angekündigt wurde. Dabei hätte er allen Grund zur Wut gehabt. Kurz nach seinem 21. Geburtstag eröffneten ihm die Ärzte, dass er an einer seltenen Muskelerkrankung leide, für die es keine Therapie gebe. Wie lange er noch zu leben habe, konnte niemand sagen, aber es war klar, dass sich sein Zustand kontinuierlich verschlechtern würde. Der junge Physik-Doktorand wusste nicht einmal, ob ihm noch genügend Zeit bliebe, seine Promotion abzuschließen.

Dann aber überlebte er alle Prognosen und erreichte das respektable Alter von 76 Jahren. Und als er im März 2018 starb, wurde der gelähmte Kosmologe für eine Weltkarriere gerühmt, die selbst für kerngesunde Forscher märchenhaft gewesen wäre: bekanntester Physiker seiner Zeit, erfolgreicher Bestsellerautor und mehrfacher Vater und Großvater. Unwillkürlich fragt man sich da: Welche Zuversicht gab ihm Kraft, woraus schöpfte Hawking seinen erstaunlichen Lebensmut? Und was lässt sich daraus lernen für unseren eigenen Umgang mit Krisensituationen?
Üblicherweise sind angesichts solcher Fragen schnell ein paar typische Empfehlungen zur Hand: Man dürfe die Hoffnung nicht verlieren, dass am Ende doch alles gut ausgehe, müsse sich in positivem Denken üben und zum Beispiel darauf vertrauen, dass auch bei unheilbaren Krankheiten noch Spontan- oder Wunderheilungen möglich seien; oder man solle sich der Religion zuwenden und seinen Glauben wiederentdecken.
Gezwungen, seine innere Freiheit zu entdecken
Stephen Hawkings Geschichte ist deshalb so bemerkenswert, weil bei ihr all diese gängigen Antworten nicht greifen: Weder erlebte er eine wundersame Heilung, noch ging seine Krankheitsgeschichte „gut“ aus. Im Gegenteil, die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), an der er litt, nahm seinen Körper genauso unerbittlich in den Schraubstock, wie die Ärzte prognostiziert hatten. Die Nervenerkrankung raubte ihm nach und nach die Kontrolle über seine Muskeln und schließlich die Stimme.
Auch mit der Hoffnung auf Gott oder andere höhere Mächte brauchte man Hawking nicht zu kommen. Der Physiker war ein durch und durch nüchterner Kopf, der mit Religion ebenso wenig anfangen konnte wie mit allen Arten von Wunderglauben oder esoterischem Hoffnungskitsch. Auf die ALS-Diagnose reagierte er so, wie wohl jede und jeder von uns darauf reagieren würde: Er empfand die Nachricht als „Schock“ und fragte sich, warum ausgerechnet ihm so etwas passiere. „Ich fühlte mich irgendwie als tragische Gestalt“, erzählt er in seinen Memoiren, er habe viel Wagner-Musik gehört und wirre Träume gehabt.
Die Berichte aber, denen zufolge er unmäßig getrunken habe, so insistierte Hawking, seien „übertrieben“ gewesen (was nicht ausschließt, dass er sich hin und wieder ein Glas genehmigte). Kurz und gut: Stephen Hawking zeigte sich als ganz normaler Mensch; er meisterte seine tiefe Krise nicht mit übernatürlichen Fähigkeiten, sondern mit denselben Mitteln, die uns allen zur Verfügung stehen.
Genau das macht ihn als Beispiel für die Kraft der Zuversicht so interessant. Denn in dem Maße, in dem ihm die äußere Bewegungsfähigkeit genommen wurde, war Hawking gezwungen, seine innere Freiheit zu entdecken. Das ist ihm offenbar so gut gelungen, dass er daraus einen enormen Überlebenswillen entwickelte. Obwohl der junge Hawking nach gängigen Maßstäben kaum eine Chance hatte, hat er sie exzellent genutzt.
Diese Art von Zuversicht können wir heute alle gebrauchen. Denn wenn es in Deutschland an etwas fehlt, dann weniger an den materiellen Mitteln oder technischen Möglichkeiten, sondern eher an der Hoffnung und Überzeugung, die gegenwärtigen Probleme bewältigen zu können. So diagnostiziert das Allensbach-Institut: „Der Zukunftsoptimismus ist steil zurückgegangen“. Das Frankfurter Zukunftsinstitut meldet: „Das soziale Klima in Deutschland ist geprägt von Gefühlen der Ohnmacht und Orientierungslosigkeit, von Überforderung und Überreizung.“ Und der Soziologe Heinz Bude erklärt: „Vor allem ein Gefühl bestimmt derzeit die Stimmung in Deutschland: die Angst.“
Das bekam auch Stephen Hawking zu spüren, als er mit über 70 Jahren einen Text über die Zukunftsaussichten der Menschheit veröffentlichte. In diesem Essay analysierte er kritisch die aktuellen Probleme, mahnte ein Umdenken an und erklärte abschließend: „Das ist machbar. In Bezug auf die Spezies Mensch bin ich ein ungeheurer Optimist.“
Was war die Reaktion? Aus den Leserkommentaren scholl ihm postwendend eine enorme Depression entgegen: „Ich teile den Optimismus für unsere Spezies nicht. Die Menschheit ist das Krebsgeschwür dieses Planeten – dieser wird sich jedoch zu heilen wissen. Wir hatten unsere Chancen. Es ist zu spät“, schrieb etwa ein Leser namens René. Der nächste legte nach: „Ich kann mich René nur anschließen, auch ich hege keinerlei Hoffnung bezüglich der menschlichen Rasse …“ Und so ging es immer weiter. Die Kommentatoren schienen sich geradezu in Hoffnungslosigkeit übertreffen zu wollen.
Nicht nur im Internet, sondern auch in Leserbriefen und in persönlichen Gesprächen stößt man immer wieder auf diese resigniert-wütende Stimmung von Menschen, die den Untergang für beschlossene Sache halten und sich nur in der Negation so richtig wohlzufühlen scheinen.
Das war seine Rettung
„Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“ – dieser flapsig dahergesagte Satz des verstorbenen Altkanzlers Helmut Schmidt hat inzwischen ein fast tragisches Gewicht bekommen. (Dabei war das nur eine ironische Bemerkung von Schmidt, mit der er die drängende Frage eines Journalisten nach seinen politischen Ideen abwehren wollte. Wer Helmut Schmidt kannte, wusste, dass dieser natürlich Zukunftsvorstellungen und politische Visionen hatte – etwa zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder zur Gestaltung Europas.)
Doch heute wagt kaum noch ein Politiker einen großen visionären Entwurf; ausgerechnet dem reichen Westen scheinen die positiven Utopien abhandengekommen zu sein. Stattdessen dominieren rückwärtsgewandte „Retrotopien“, wie sie der Sozialphilosoph Zygmunt Bauman genannt hat – „Visionen, die sich anders als ihre Vorläufer nicht mehr aus einer noch ausstehenden und deshalb inexistenten Zukunft speisen, sondern aus der verlorenen/geraubten/verwaisten, jedenfalls untoten Vergangenheit“ – eben Retro- statt Utopien.
So erleben wir derzeit nicht nur eine Energiekrise in Bezug auf fossile Brennstoffe, sondern auch im Hinblick auf unsere seelischen Ressourcen: Was uns hinsichtlich der Zukunft vielleicht am meisten fehlt, ist die Antriebsenergie der Zuversicht und damit der grundlegende Treibstoff des Lebens.
Dabei geht es allerdings nicht um die naive Hoffnung, dass am Ende irgendwie alles wieder ins Lot komme. Die Zuversicht, von der hier die Rede ist, meint auch nicht jenen stählernen Optimismus, dem zufolge es keine Krisen und niemals leere Gläser gibt, sondern immer nur Chancen und halb volle Gläser. Diese Art von positivem Denken gilt ja mancherorts schon als emotionaler Imperativ. Dabei trübt der ständige Blick durch die rosarote Brille die Sicht eher, als dass er sie schärft.
Eingängig lässt sich der Unterschied zwischen Zuversicht, Optimismus und Pessimismus anhand der berühmten Parabel von den drei Fröschen illustrieren, die in einen Topf Sahne fallen.
Der Pessimist denkt: „Oje, wir sind verloren, jetzt gibt es keine Rettung mehr.“ Sagt’s und ertrinkt. Der Optimist gibt sich unerschütterlich: „Keine Sorge, nichts ist verloren. Am Ende wird uns eine höhere Macht retten.“ Er wartet und wartet – und ertrinkt ebenso sang- und klanglos wie der erste. Der dritte, zuversichtliche Frosch hingegen sagt sich: „Schwierige Lage, da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu strampeln.“ Er reckt den Kopf über die Oberfläche und strampelt und strampelt – bis die Sahne zu Butter wird und er sich mit einem Sprung aus dem Topf retten kann.
Zuversicht heißt also nicht, illusionäre Hoffnungen zu hegen, sondern einen klaren Blick für den Ernst der Lage zu behalten; zugleich heißt Zuversicht aber auch, sich nicht lähmen zu lassen, sondern die Freiräume zu nutzen, die sich auftun – und seien sie noch so klein.
Das lehrt auch Stephen Hawkings Geschichte. Statt in Selbstmitleid zu versinken, fokussierte er sich klugerweise auf jene Spielräume, die ihm blieben. Er nahm sein Schicksal an, heiratete seine geliebte Jane und beschäftigte sich mit dem, was ihm am meisten Freude machte: Astrophysik. „Meiner Meinung nach“, sagte er, „sollten sich behinderte Menschen auf die Dinge konzentrieren, die ihnen möglich sind, statt solchen hinterherzutrauern, die ihnen nicht möglich sind.“

Wenn man ihn interviewte, sprach er stets lieber über Kosmologie als über sein Befinden. Nabelschau lag dem Physiker erkennbar nicht – und das war wohl seine Rettung. Denn es gab etwas, das ihn mehr interessierte als das Kreisen um sich selbst und das eigene Wohl und Weh. So lieferte Hawking den praktischen Beleg für einen berühmten Satz von Friedrich Nietzsche: „Hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie.“ Hawking hatte ganz offensichtlich sein Warum des Lebens gefunden.
Liebe, Humor und Sinnhaftigkeit
Das heißt nicht, dass in jeder Krise das Studium der Astrophysik anzuraten wäre. Vielmehr geht es darum, seinem ganz persönlichen „Warum“ zu folgen, jener Aufgabe oder Tätigkeit, die einem sinnvoll und befriedigend erscheint – so wie es der tschechische Menschenrechtler und Staatspräsident Václav Havel einmal ausdrückte: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“
Diese Gewissheit kann zahllose Formen annehmen: Für die einen ist sie mit politischem Engagement verbunden, für andere mit der Erziehung der eigenen Kinder, wieder andere gehen in der Beschäftigung mit Kunst, Literatur, Musik oder altbyzantinischer Kirchenmalerei auf – vermutlich gibt es ebenso viele Warums, wie es Menschen gibt.
Von der „Kraft der großen Sache“ sprach in diesem Zusammenhang einmal Nelson Mandela, auch so ein Prototyp des zuversichtlichen Menschen. 27 Jahre seines Lebens musste er hinter Gittern verbringen, eingekerkert wegen seines Kampfes gegen die Apartheid. Dennoch ließ er sich nicht brechen. Während seiner langen Haft schien er innerlich sogar zu wachsen und an Stärke zu gewinnen – so sehr, dass er die Identifikationsfigur aller Unterdrückten weltweit und später der erste schwarze Präsident Südafrikas wurde.
Möglich war das nur, weil Mandela – ähnlich wie Hawking – weniger an sich selbst als an die „große Sache“ dachte, der er sich verschrieben hatte. Es lohnt sich also, Ausschau nach solchen als sinnvoll erachteten Aufgaben zu halten – denn diese „Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht“, ist es, die Menschen in Krisensituationen hilft, den Kopf über Wasser zu halten.
Wer damit Mühe hat, dem bleiben immer noch Liebe und Humor. Was ihn am Leben gehalten habe, erklärte Hawking einmal, sei die Liebe der Frauen gewesen, die ihn umsorgten. Außerdem war der gelähmte Kosmologe mit großem Witz gesegnet und liebte die lakonische Pointe. So erklärte er etwa in gespieltem Ernst, seine Behinderung sei durchaus von Vorteil: Er müsse keine Vorlesungen halten, keine Studienanfänger unterrichten und nicht an zeitraubenden Sitzungen teilnehmen. Solche selbstironischen Kommentare brachten nicht nur sein Umfeld zum Lachen; sie waren auch ein hervorragendes Mittel gegen die Verführung des Selbstmitleids und die allzu starke Identifizierung mit dem eigenen Leid.
Vielleicht ist das am Ende, jenseits aller Theorien über Schwarze Löcher, die wichtigste Botschaft, die uns Stephen Hawking hinterlassen hat: Dass es selbst angesichts schwierigster äußerer Umstände immer noch Möglichkeiten und Spielräume gibt, das Leben sinnvoll und zuversichtlich zu gestalten – und dass auf diese Weise manchmal Entwicklungen möglich sind, die realistischerweise niemand hätte erwarten können.
Dies ist ein Auszug aus dem neuen Buch von Ulrich Schnabel: „Zuversicht. Die Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute wichtiger ist denn je“. Blessing Verlag, München; 255 S., 22,– €.

